Letzte Aktualisierung am 27. März 2020
Im ersten Teil habe ich die Geschichte von der Kassette bis zum Streaming abgehandelt, nun soll es um die verschiedenen Ansätze von Spotify und Apple Music gehen. An dieser Stelle sei auf einen Technik-Talk zum Thema Streaming verwiesen, in dem wir damals auch einen Rück- und Ausblick gewagt haben. Mein persönlicher Anspruch sei an dieser Stelle nochmal zusammengefasst, so möchte ich meine eigene Musik mit dem Angebot der Streaming-Datenbank vermengen, denn nicht alles ist trotz reichhaltigem Angebot vorhanden.
Genau wie das Album auf dem Titelbild sind auch dies Beispiele aus den 80er Jahren, die mir nur als Vinyl vorliegen und nicht in das digitale Zeitalter gerettet wurden. Italo Disco war ein Genre, das mit wenig Budget auskommen musste und die Produktion von Vinyl war damals günstiger. Während sich große Plattenfirmen primär mit der Neuauflage von Oldies befassten, wurde das populäre Genre mit Ausnahme bekannter Künstler etwas vernachlässigt. Später wurden zwar viele, jedoch nicht alle Masterbänder digitalisiert und auf Kompilationen veröffentlicht, so erlebte Italo Disco seine Renaissance erst Mitte der 90er Jahre unter dem Label XYZ. Die gezeigten Schallplatten konnte ich später selbst digitalisieren, zuvor jedoch nur als brauchbare Kopien aus Tauschbörsen herausfischen. Heute lassen sich diese Werke nicht im digitalen Plattenladen oder auf CD erwerben, weshalb Tauschbörsen meiner Ansicht nach maßgeblich zur Wahrung des Kulturguts beigetragen haben. Ohne die initialen Downloads hätte ich diese Schallplatten bei eBay wohl nie finden können. Zurück zum Thema, denn während es sich hierbei um Ausnahmefälle handelt, bewerben Streaming-Dienste ihr Repertoire von über 40 Millionen Titeln. Das ist eine ganze Menge und trotzdem gibt es spürbare Abweichungen.
Keine Rolle wird im Folgenden die Musikqualität spielen. Mit Qobuz und Tidal gibt es zwar Anbieter, die mit besonders guter Audioqualität werben, hier sollte man jedoch stets die limitierenden Faktoren der lokalen Wiedergabekette im Blick behalten. Selbst Bluetooth 5.0 mit aptX-HD kommt beispielsweise kaum über den Status gut komprimierter Musik hinaus, hochauflösende Daten werden somit schlechter recodiert. Die Wandler gängiger Mobilgeräte quantisieren zwar mit 24 Bit, jedoch bei einer Abtastrate von 48 kHz. Was im Innern von Smart Speakern wirklich passiert, vermögen nur die Hersteller zu wissen und so muss man schon technischen Aufwand betreiben, wenn man diese Qualität bis zum Schallwandler beibehalten möchte. Bei den Anbietern liest sich das zwar alles ganz nett, schlussendlich sind aber hochwertige Audiogeräte die Konsequenz. Konsumiert man Musik hauptsächlich mobil, ist neben Bluetooth auch die Datenrate der limitierende Faktor. Bei einem Grundpreis von rund 30 Euro monatlich bezahlt man im Jahr rund 360 Euro für HD-Streaming, dafür kann man sich allerhand hochauflösende Musikalben kaufen. Genau das ist für mich das Argument gegen diese Dienste, denn das bewusste Einschränken erhöht ohne Zweifel den Genussfaktor.
Recht auf Medienbesitz muss Vertragsbestandteil werden!
Beginnen möchte ich mit einem Thema, das die Politik offenbar nicht wahrnimmt, der Besitz gekaufter Medien. Denn im Gegensatz zu Spotify und Netflix verkaufen Amazon, Apple, Google und Microsoft digitale Inhalte, die teilweise mit Streaming verknüpft werden. Während man inzwischen bei allen Anbietern Kaufmusik mit digitaler Signatur kopierschutzfrei herunterladen kann, verbleiben Filme und Bücher in den jeweiligen Konten. Wenn man wie ich die Nase gestrichen voll von Amazon hat und das eigene Konto löscht, verliert man zugleich und unwiederbringlich den Zugriff auf die gekauften Inhalte. Dies gilt genauso für Apps, die jedoch am Ehesten an einer Plattform hängen.
Daher ist dringend ein Recht auf die Übertragung digitaler Inhalte notwendig, das über eine einheitliche Schnittstelle durchsetzbar sein muss. Ziehe ich beispielsweise von Apple zu Google um, möchte ich meine Mediathek künftig dort verwenden, zugleich muss natürlich der Zugriff beim ursprünglichen Anbieter entfallen. Damit wird verhindert, dass Artikel mehrfach gekauft und genutzt werden und die zwangsweise Kundenbindung entfällt. Man stelle sich vor, dass jeder Hersteller von CD-Playern ein eigenes Tonträgerformat auf den Markt bringen würde und wer Sony nutzt, könnte diese nicht mit Philips-Laufwerken abspielen. So gibt Es folglich bei digitalen Anbietern keine Standards und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Während man Filme und Bücher von Google und Amazon wenigstens auf Geräten von Fremdherstellern abspielen kann, lassen sich Medien von Apple nur im eigenen Universum konsumieren, für Musik gilt dies jedoch nicht. Vernachlässigt man den Umstand, dass einige Hersteller iTunes in ihre Fernsehgeräte einbauen, ist daher mindestens ein iPad zum Konsum nötig. Das Löschen des Kontos wäre somit ein wirtschaftlicher Totalschaden, denn bei reger Nutzung wird man über die Jahre einen vierstelligen Betrag in Medien und Apps investiert haben.
Dieser Umstand erschwert es mir, mit digital erworbenen Medien abseits von Musik unverkrampft umgehen zu können. Da ich weniger Wert auf Filme und Bücher lege, ist die freie Verwendung digitaler Musik für mich das ausschlaggebende Argument für den Kauf. So konnte ich die Musik aus meinem Amazon-Konto sichern, wohl aber gingen Kindle-Bücher verloren und Filme habe ich aus diesem Grund gar nicht erst gekauft. Google ist hier übrigens positiv hervorzuheben, denn erworbene Filme lassen sich sogar in YouTube verschlüsselt anschauen. Musik, die mir wichtig ist, kaufe ich ohnehin nicht in MP3-Qualität, sondern hochauflösend und bezahle dafür nur unwesentlich mehr als für die CD-Version in entsprechend minderer Qualität. Schallplatten sind alleine von der Haptik und dem Mehr an Platz regelrechte Kunstwerke und kaum durch andere Medien zu ersetzen. Meist erhält man zugleich eine Digitalkopie oder CD im Cover, so dass man auch nicht auf die Digitalwelt verzichten muss. Das ist auch gut so, denn die Schallplatte ist klanglich limitiert und die Investition in teure Plattenspieler und Tonabnehmer relativ sinnlos, auch wenn das viele Fans der Analogtechnik anders betrachten werden. Fakt ist jedoch, dass die heutige Digitaltechnik in Auflösungen vorgedrungen ist, die man schon als semianalog bezeichnen kann, selbst DSD128 übertrifft klanglich den teuersten Plattenspieler.
Flexible Bezahlmodelle wären wünschenswert
Weil die meisten Dienste laufende Kosten verursachen, wird man sich nur für einen entscheiden. Dabei bietet Spotify einen kostenlosen und werbefinanzierten Zugang an, so dass viele Nutzer diesen auch als Zweitaccount behalten können. Die Verbindung zu Spotify Connect soll auch in der Basisvariante möglich sein, getestet habe ich dies jedoch nicht. Einschränkungen erfährt man neben Werbeeinblendungen dadurch, dass man nur zufällige Titel bei schlechterer Qualität abspielen kann. Generell bezahlt man bei allen Diensten rund zehn Euro für eine Einzelperson oder rund 15 Euro für einen Familienaccount, die Kündigung kann dabei monatlich erfolgen. Hierbei haben sechs Personen Zugriff, die sich im selben Haushalt aufhalten müssen. Während Spotify das auch überprüft und mitunter das Abo einseitig kündigt, scheint das beim französischen Anbieter Deezer anders zu sein. Dabei ist jeder Dienst daran interessiert, dass die Nutzer in der jeweiligen Filterblase bleiben. Aufwendig erstellte Playlisten und Mediatheken wirken wie eine Geißel, die aktive Nutzung bindet folglich immer enger an den Dienst.
Eine sinnvolle Lösung wäre ein monatsabhängiger Betrag, der nur bei einer Mindestnutzung anfällt. Würden mehrere Dienste so ein Modell anbieten, könnte ich mich bei allen registrieren. Je nach Anforderung nutze ich mal mehr Apple Music, Google Play Music, Spotify oder Deezer und zahle nur dann, wenn ich beispielsweise 30 Minuten im Monat Musik gehört habe. Nutze ich die App zeitweise nicht, zahle ich gar nichts. Das hätte für die Anbieter den Vorteil, mehr potentielle Nutzer zu gewinnen, denn ein aktivierter Dienst nutzt sich leichter als ein Dienst ohne Konto. Gäbe es ein solches Modell für Netflix, hätten sie mich als Kunden gewonnen, ansonsten ist mein Filmkonsum zu gering und der Preis im Verhältnis subjektiv zu hoch. Man sollte jedoch nicht glauben, dass Streaming ein ertragreiches Geschäft wäre. So mussten deutsche Anbieter, wie Simphy für Musik und Watchever für Filme, ihr Angebot schon nach wenigen Jahren einstellen.
Vorsicht beim Kauf auf eBay, hier wird Spotify Premium für ein oder zwei Jahre und Abos für andere Dienste angeboten. Es handelt sich dabei um keine Gutscheine, sondern die Teilnahme an fremden Familienaccounts. Das verstößt eindeutig gegen die Nutzungsbedingungen, man gibt auch eine E-Mail-Adresse aus der Hand und muss hoffen, dass wenigstens der Verkäufer es gut meint. Da kann man noch so häufig lebenslange Zugänge versprechen oder das Rücktrittsrecht bei digitalen Inhalten verweigern, das ist und bleibt unzulässig und der Dienst kann solche Konten deaktivieren. Sparen lässt sich hingegen mit Gutscheinkarten, die man im Internet oder Supermarkt bekommt. Im Voraus kann man für viele Dienste jährlich 99 Euro bezahlen, ein wie ich finde faires Angebot. Bei Google und Apple lässt sich weiter sparen, wenn man rabattierte Guthabenkarten erwirbt, das jährliche Abo kann man außerdem in iTunes buchen. Spotify bietet solch ein Modell nicht direkt an, hier ist einzig die monatliche Vorauszahlung im Kundenkonto für Spotify Premium oder Premium Family buchbar. Weil Apple für In-App-Käufe 30 Prozent erhebt, 15 im Folgejahr, sind die Abos dort teurer oder werden gar nicht angeboten. Vergleichen lohnt sich daher immer, auch wenn die direkte Buchung über Apple und Google bequemer ist.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Befasst man sich mit der Frage ob Streaming für Musiker und Künstler eher gut oder schlecht ist, kommt Spotify aufgrund der geringen Entlohnung für Musikschaffende nicht gut bei weg, zwischenzeitlich boykottierten manche Künstler wie Taylor Swift und Herbert Grönemeyer den Dienst, um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Das Startup im Schwedischen Stockholm wollte 2006 den Tauschbörsen etwas entgegensetzen und seit 2008 ist der Dienst buchbar. Der anfängliche Facebook-Zwang und Kritik an der Datensammelleidenschaft veranlasste Spotify zu Veränderungen, Facebook ist heute kein Pflichtprogramm mehr. Im Jahr 2018 konnte das Unternehmen erstmals Gewinne einfahren und ist inzwischen sogar börsennotiert. Im Prinzip ist es ein soziales Musiknetzwerk, denn Spotify arbeitet mit Playlisten, die geteilt und ergänzt werden können. Zwar lassen sich auch Alben in Favoriten aufnehmen und komplett anhören, das dürften jedoch die wenigsten Nutzer tun. So reißt man die Titel aus dem Kontext des Gesamtwerks und durch den besonders guten Algorithmus lernt Spotify die Nutzer immer besser kennen und wird faktisch zum persönlichen Lieblingsradio. Künstlerseiten sortieren übersichtlich die zugehörigen Alben und Links zu Fanartikeln führen zu den Shops, auch können Konzerttermine abgerufen und Karten vorbestellt werden. Podcasts sind ebenfalls integriert, so auch gesprochene Inhalte, bei Apple gibt es dafür separate Apps. Ganz toll finde ich die Empfehlungen und was andere Freunde hören. So lässt sich in öffentlichen Playlisten anderer Nutzer stöbern, die auch versteckt werden können und man entdeckt sehr viel neue Musik.
Apple Music ging aus iTunes hervor, das primär als digitaler Plattenladen vorgesehen war. Während man mit iTunes Match zunächst die Online-Synchronisation eigener Musik einführte, wurde mit Apple Music das Musikhören zum Pauschalpreis möglich. Google Music wurde bereits früher eingeführt und funktioniert nach ähnlichem Prinzip und kann wie Spotify auch im Browser genutzt werden. Während man bei Spotify jedoch nur den verfügbaren Musikkatalog nutzen kann, lässt sich gehörte Musik bei Google und Apple kaufen, eigene Musik kann zudem hochgeladen werden. Während Spotify als Dienst mit der meisten Verbreitung fast überall präsent ist, limitiert Apple seinen Dienst auf die eigenen Geräte, was ihn selbst für iPhone-Nutzer eher unattraktiv macht. Das Angebot wird über Radiosender und eigene Produktionen ergänzt, Musikvideos sind bei Spotify hingegen in der Unterzahl. Apple Music bietet wie Google Play Music auch Playlisten an, die als virtuelle Radiosender Titel bestimmter Genres abspielen. Das funktioniert nicht immer gut, beim Genre Pop kann es nach 30 Minuten passieren, dass man nur noch Hip-Hop hört. Mit Beats 1 präsentiert man einen Radiosender mit Interviews und Musiksendungen in englischer Sprache, auch eigens produzierte Serien wie Carpool Karaoke. Eigentlich wollte Apple ein soziales Netzwerk für Künstler und Fans aufbauen, diese Funktion wurde inzwischen wieder eingestellt. Neue Musik entdecken ist zwar auch möglich, im Vergleich zu Spotify jedoch nicht so intuitiv.
Im Prinzip funktionieren alle Musikdienste ähnlich, man sucht einen Titel, Interpret oder Album, fügt das Ergebnis in die Bibliothek hinzu und kann Medien zum Offlinehören herunterladen. Auch Spotify hat das Hochladen von eigener Musik angeboten, wie bei Amazon wurde diese Funktion allerdings eingestellt. Die Desktop-App kann auf lokale Medien zugreifen, jedoch in sehr beschränkter Form, dass man besser einen üblichen Player nutzt. Gesucht wird allerdings nur in der Spotify-Datenbank.
Ergonomie und Flexibilität
Während Google Music auf Google Cast als Schnittstelle zu externen Geräten setzt, nutzt Apple das hauseigene AirPlay-Protokoll. Dabei kann auch Bluetooth genutzt werden, hier sind jedoch die schon erwähnten Einschränkungen zu beachten. Während der Chromecast Audio die Musik nicht vom Smartphone sondern direkt über das Internet empfängt, muss bei AirPlay das iPhone, iPad oder der Mac zwangsweise eingeschaltet sein. Schaltet man das Gerät ab, verstummt die Musik. Im Akkubetrieb wird dadurch auch ein höherer Stromverbrauch nötig. Die Apple Watch Cellular ist eine Ausnahme, denn sie kann Apple Music direkt aus dem Internet abrufen, mit Spotify gelingt dies aktuell noch nicht. Dafür schränkt Apple derzeit die Nutzung des HomePod noch sehr ein, der ohne Apple Music einen Großteil seiner Nutzbarkeit verliert. Hingegen stellt Apple einen Skill für den Amazon Echo bereit und öffnet sich weiter, auf ausgewählten Fernsehgeräten ist iTunes vorinstalliert. Das Apple TV ab Version 4 eignet sich aufgrund mangelnden optischen Ausgangs nicht, der Airport Express hingegen kann als AirPlay-Schnittstelle dienen.
Spotify macht hier vieles anders und auch wesentlich klüger. Zunächst werden auf allen Geräten derselbe Stand angezeigt. Höre ich unter Windows einen Titel, kann ich ihm am iPhone weiterhören oder ein Android-Gerät als Wiedergabeziel wählen. Dabei lässt sich die Wiedergabe unter einer Sekunde auf ein kompatibles Gerät mit installierter App oder Spotify Connect umlegen. Vereinfacht beschrieben nutzt man Spotify wahlweise in der App direkt oder trennt die Steuerung und Wiedergabe auf zwei Apps oder Geräte auf. Die Fernbedienung lässt sich wechseln, so kann die Apple Watch spontan zur Steuerung des Wiedergabeziels genutzt werden, dabei können alle Apps weiterlaufen und die Wiedergabe lässt sich schnell umschalten. Diese ist nämlich nur auf einem Gerät möglich und nicht übergreifend, für mehrere Räume würde man Smart Speaker kaskadieren müssen. Das verbraucht deutlich weniger Energie und sorgt für eine homogene Nutzererfahrung, weil wie im obigen Beispiel das iPhone nicht eingeschaltet bleiben muss. Von Nachteil ist hingegen, dass man Spotify dadurch nicht von mehreren Familienmitgliedern gleichzeitig nutzen sollte, weil jeder einen anderen Geschmack hat und das intelligente System weniger effizient arbeitet. Was noch fehlen würde wäre die autarke Nutzbarkeit auf der Apple Watch, die vorhandene App taugt entsprechend nur zur Steuerung, ohne iPhone ist Spotify derzeit nicht mit der smarten Uhr nutzbar.
Warum der Wechsel?
Schuld war eigentlich ein Probe-Abonnement von Spotify, denn ursprünglich hatte ich weder vor zu wechseln, noch verstanden, was alle an Spotify so toll finden. Gehalten an Apple Music hat mich neben der Apple Watch die Speicherung eigener Titel, die sich auch in Playlists integrieren lassen. Von Nachteil ist die Vermengung allerdings deshalb, weil doppelte Einträge auftauchen und Beschriftungsfehler das ganze Archiv versauen können. Bei Spotify genieße ich den Service der vordefinierten Datenbank, an der ich selbst nichts verändern kann und die redaktionell auch gepflegt wird. Immerhin ließen sich Pop-Sampler über Playlists nachbauen, eine Erkennung von Barcodes und Musik wäre hilfreich. Letzteres lässt sich lösen, so kann man SoundHound und Shazam mit Spotify verbinden. Das Thema Pop-Sampler ist jedoch so eine Sache, denn Bravo Hits und Co. Finden sich nicht in den Musikkatalogen, man muss sie käuflich erwerben und das geht bei Spotify entsprechend nicht. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil ist die nahtlose Integration in DJay von Algoriddim. Diese DJ-Software gibt es für nahezu alle Betriebssysteme und ermöglicht ein unerschöpfliches DJ-Setup für wenig Geld bekommt.
In der Praxis zeigte sich, dass ich von Apple Music im Wesentlichen nur mein Archiv nutze. Nur gelegentlich höre ich fremde Musik, weil sie auch hermetisch bei der Suche getrennt wird. Allerdings lädt Apple Music diese zum Teil automatisch herunter, bei Spotify muss ich schon selbst dafür sorgen, die Medien offline verfügbar zu machen. Weiterhin gab es immer Synchronisationsprobleme, so wurden hochgeladene Titel in Apple Music als nicht verfügbar angezeigt oder Alben wurden nicht vollständig geladen. Hinzu kommt die fehlende FLAC-Unterstützung und teilweise schlechte Qualität meiner Exemplare, die bei Spotify alle gleich gut klingen. Das gilt auch für Apple Music und Google Play Music, wenn man diese statt dem Hochladen hinzufügt. Dann allerdings verschwindet auch der Vorteil der eigenen Musik und man kann sich bei der Wahl des passenden Dienstes auf Klangqualität, Ergonomie und Angebot beschränken. Eine kleine Einschränkung von Spotify ist, dass sich maximal fünf Geräte für das Offlinehören synchronisieren lassen,Diese können im Online-Konto wieder entfernt werden und erscheinen erst, wenn man einen Download startet. Diese Funktion wird man folglich nicht bei Computern nutzen, die stets am Internet hängen, für Smartphones und Tablets lässt sich auf diese Weise das mobile Datenvolumen spürbar entlasten. So können ganze Playlisten in einem Rutsch geladen werden, einschließlich redaktionell gepflegte Wiedergabelisten. Das geht bei Apple und Google auch, wobei Apple Music gleichzeitig auf je fünf Computern und Mobilgeräten aktiviert werden kann, hier wird jedoch nicht zwischen Streaming und Download unterschieden.
Der AirLino von Lintech ist die Schnittstelle zwischen Streaming und HiFi-Anlage, lässt sich vollständig per App steuern und bietet sogar ein eigenständiges Internet-Radio. Spotify Connect macht ihn zum besseren Spielpartner, denn trotz dass er AirPlay und in der Plus-Version sogar Bluetooth beherrscht, zeigt sich Spotify Connect als deutlich stabiler und flexibler. Mit Apple Music bin ich an ein Gerät gebunden und muss beim Wechsel die Wiedergabe umständlich neu starten. Bei Spotify starte ich die App und sie erkennt, dass der AirLino bereits Musik abspielt. Gefällt ein Titel, lässt er sich mit einem Klick in die Liste der Lieblings-Songs einfügen. Das Löschen, auch von Alben, gelingt übrigens genauso schnell, da muss man etwas vorsichtig sein. Ein weiterer Vorteil von Spotify Connect ist, dass jeder Nutzer in meinem Netzwerk auf die Geräte zugreifen kann und sie ohne initiales Verbinden direkt ansteuern kann. Das sorgt mitunter für lustige Effekte, wenn Besucher mal eben mein Musikangebot durch das eigene ersetzen.
STAMP, der Playlistretter
Nutzt man über Jahre einen Streaming-Dienst, sammeln sich viele Daten an, Wiedergabelisten, Hörverlauf, Alben und Künstler werden markiert, nicht nur bei der Ersteinrichtung. Wer viele Playlisten erstellt hat, verbindet dies nicht nur mit viel Arbeit, sondern auch mit Emotionen. Wird ein Dienst gekündigt, ist die Klappe zu und die Daten bleiben bis zur Neubuchung erhalten. Dies nutzt einem nur wenig, wenn man den Dienst gänzlich verlassen will. Dieser Umstand sorgt für die Kundenbindung, weil niemand seine Musik verlieren möchte, die man nicht besitzt, was einem in diesen Momenten klar wird.
Weil die Anbieter aus eigenem Interesse den Umzug nicht anbieten, müssen Drittanbieter mit unterschiedlichen Lösungen ran. Teils online, so dass man die Zugangsdaten aus der Hand geben muss, teils jedoch auch als lokales Programm. Bei Diensten im Web bin ich grundsätzlich vorsichtig, weshalb für mich nur ein eigenständiges Programm in Frage kam. Mit STAMP bin ich auf eine Anwendung gestoßen, die als ausführbare Datei sofort einsatzbereit ist und auch für Mobilgeräte zur Verfügung steht. Für knapp über 12 Euro bekommt man eine kombinierte Lizenz für alle Geräte, die auch sämtliche Updates enthält. Die Nutzung ist dabei sehr einfach, man verbindet sich mit dem Quell- und Zieldienst, wählt anschließend die zu übertragenden Wiedergabelisten und startet schließlich den Transfer. Dabei zeigten sich in meinem Fall spannende Effekte, so wurden Titel nicht nur ausgelassen, sondern waren im Ergebnis gänzlich andere, teilweise sogar Hörbuchauszüge. Dennoch hat die Software sicher ihr Bestes versucht und trotzdem war ich erstaunt, wie viele Titel schlussendlich nicht erkannt wurden. Bei einer Wiedergabeliste mit rund 800 Titeln fehlten bestimmt 20 Prozent. Die Frage ist jedoch, ob mir dies Erstens überhaupt auffällt und Zweitens die betroffenen Titel überhaupt für mich noch relevant sind. Eine logische Erklärung dafür gibt es jedoch, denn meine ursprüngliche Playlist enthält sehr viele Titel der Bravo Hits, die entsprechend nicht bei Spotify gelistet sind. Im Ergebnis ist trotz der paar Verluste der Umzug erfolgreich verlaufen, denn händisch hätte ich deutlich mehr Zeit investieren müssen.
Fazit
Sicher hat jeder Streaming-Dienst seinen Charme. Für Spotify spricht allerdings ganz klar die Verbreitung und Integration in zahlreiche Produkte, die sich ohne viel Konfigurationsaufwand sofort nutzen lassen. Für Apple Music und Google Play Music spricht die Integration eigener Inhalte, gegen iTunes spricht die lahme und ressourcenfressende Anwendung, die in den nächsten Versionen jedoch überarbeitet werden soll. Google Play Music gibt es für alle Betriebssysteme, weil sich der Dienst auch im Browser nutzen lässt. Dagegen spricht allerdings auch die relativ geringe Verbreitung von Google Cast, die jedoch inzwischen AirPlay überlegen sein dürfte. Nichts desto trotz ist Spotify der Platzhirsch und wenn man sich etwas damit beschäftigt, merkt man dies auch an allen Ecken und Enden. Da kann ich auf den Import mancher Alben verzichten, muss allerdings jedes gekaufte Werk umständlich einpflegen. Nötig ist das jedoch nicht, das Suchfeld und der Gedanke an ein Album sind hier der Problemlöser. STAMP als Beispiel kann helfen, die aufwendig gestalteten Playlisten umzuziehen, jedoch sind Verluste ebenso garantiert. Daher ist es für den Wettbewerb wichtig, dass die Übernahme digitaler Inhalte geregelt werden muss. Ansonsten freuen sich die Dienste über immer enger werdende Nutzerbindungen.




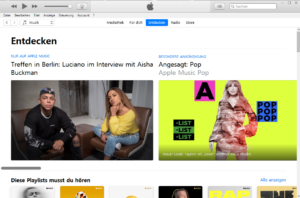


Sei der Erste, der das kommentiert